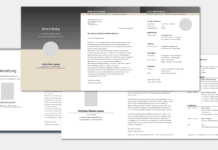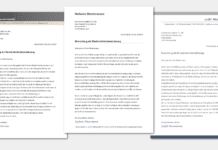Inhaltsübersicht:
Darf man Mitarbeiter filmen? Was im Job erlaubt ist und was nicht
Viele Arbeitgeber wissen gern genau, was ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit machen. Vor diesem Hintergrund kann der Wunsch aufkommen, die Mitarbeiter zu filmen. Aber ist das überhaupt erlaubt? In welchem Rahmen Videoüberwachung am Arbeitsplatz möglich ist und was Arbeitnehmer tun können, die nicht gefilmt werden möchten, erfährst du hier.
Warum manche Arbeitgeber ihre Mitarbeiter filmen
In ihre Mitarbeiter stecken Arbeitgeber viel Geld. Da ist es nachvollziehbar, dass sie sicherstellen wollen, dass dieses Geld gut investiert ist und die Arbeitskräfte ihren Job gut machen. Im besten Fall herrscht zwischen Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern ein gutes Vertrauensverhältnis. Der Chef oder die Chefin weiß, dass die Beschäftigten engagiert, vertrauenswürdig und zuverlässig sind.
Den Mitarbeitern einfach zu vertrauen, halten manche Arbeitgeber jedoch für naiv. Es gibt schließlich immer wieder Arbeitnehmer, die sich während der Arbeitszeit lieber privaten Dingen widmen, wenn sie sich ungestört fühlen, oder das Unternehmen sogar bestehlen.
Wer nicht sicher ist, ob seine Mitarbeiter vertrauenswürdig sind, geht oft lieber auf Nummer sicher, indem er sie kontrolliert. Eine Möglichkeit ist dabei die Videoüberwachung am Arbeitsplatz. Wenn Arbeitgeber sich dazu entscheiden, Mitarbeiter zu filmen, kann es unterschiedliche Beweggründe dafür geben.
Bei der Videoüberwachung im Job kann der Wunsch im Vordergrund stehen, Diebstahl und Sachbeschädigung zu verhindern. Es kann auch darum gehen, sicherzustellen, dass die Beschäftigten wirklich arbeiten, statt zum Beispiel privat im Internet zu surfen. Oder das Ziel besteht darin, die Arbeitsabläufe besser zu überwachen und eine hohe Qualität sicherzustellen.
Videoüberwachung am Arbeitsplatz kann sowohl helfen, Fehlverhalten aufzudecken, als auch, es zu verhindern. Wenn die Beschäftigten wissen, dass sie bei der Arbeit überwacht werden, werden sie sich eher pflichtgemäß verhalten. Wem bewusst ist, dass im Hintergrund eine Kamera läuft, der wird sich kaum intensiv seinem Handy widmen oder Geld aus der Kasse stehlen.
Gesetzliche Bestimmungen: Darf man Mitarbeiter bei der Arbeit filmen?
Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter filmen möchten, sehen darin oft kein großes Problem. Auf der Seite der betroffenen Beschäftigten sieht das in vielen Fällen ganz anders aus. Per Video überwacht zu werden, greift massiv in die Persönlichkeitsrechte ein. Doch was gilt gesetzlich: Ist Mitarbeiter filmen erlaubt?
Grundsätzlich ist es nur erlaubt, Mitarbeiter zu filmen, wenn das innerhalb der geltenden gesetzlichen Regelungen geschieht. Die Vorgaben zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz ergeben sich insbesondere durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Was nicht geht, ist eine pauschale Überwachung aller Mitarbeiter in allen Bereichen. In begründeten Einzelfällen kann eine Videoüberwachung jedoch gesetzeskonform sein.
- Zulässig kann es nur dann sein, Mitarbeiter zu filmen, wenn es einen konkreten Anlass dazu gibt. Um diesen Zweck zu erreichen, darf es kein milderes Mittel geben. Ein Beispiel: Um Diebstahl im Job zu verhindern, könnte der Arbeitgeber Wertgegenstände auch besser schützen, etwa mit einem Vorhängeschloss. Die Mitarbeiter zu filmen, wäre dann nicht nötig.
- Videoaufzeichnungen am Arbeitsplatz müssen außerdem verhältnismäßig sein. Der Nutzen, den der Arbeitgeber dadurch hat, muss stärker wiegen als die schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte der gefilmten Mitarbeiter.
Ist verdeckte Videoüberwachung erlaubt?
Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter filmen möchten, müssen diese darüber informieren. Sie müssen darlegen, warum sie die Beschäftigten filmen, wie lange die Aufzeichnungen gespeichert werden und in welcher Form. Arbeitskräfte haben auch ein Recht darauf, zu erfahren, wer auf die Videoaufnahmen zugreifen kann.
Nicht jeder Arbeitgeber informiert seine Mitarbeiter darüber, dass sie bei der Arbeit gefilmt werden. Verdeckte Videoüberwachung ist jedoch in der Regel nicht erlaubt. In Ausnahmefällen kann das anders sein: wenn ein konkreter Verdacht besteht, dass jemand eine Straftat begeht, und es keine milderen Mittel gibt, um das zu überprüfen.
Besonders schwerwiegend für die gefilmten Beschäftigten sind Videoaufnahmen mit Ton. Tonaufnahmen sind fast immer verboten. Arbeitgeber, die dagegen verstoßen, können sich strafbar machen. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen erlaubt, wenn die Betroffenen dem zugestimmt haben. Das heißt, dass heimliche Tonaufnahmen nahezu immer gegen das Gesetz verstoßen.
Arbeitgeber dürfen nicht alleine entscheiden, dass und wie sie ihre Mitarbeiter filmen. Wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, hat er ein Mitbestimmungsrecht. Arbeitgeber und Betriebsrat entscheiden dann gemeinsam, wie die Videoüberwachung am Arbeitsplatz konkret aussieht.
In welchen Bereichen ist es erlaubt, Mitarbeiter zu filmen?
Ob es erlaubt ist, Mitarbeiter zu filmen, hängt auch davon ab, wo sie arbeiten. Am ehesten möglich ist Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Arbeitsbereichen. Das können zum Beispiel die Verkaufsflächen von Supermärkten oder ein Flughafen sein.
Die Mitarbeiter dürfen in solchen Fällen gefilmt werden, sofern der Arbeitgeber damit einen Zweck verbindet. Er muss ein berechtigtes Interesse an den Aufnahmen haben. Ebenfalls möglich ist Videoüberwachung in solchen Bereichen, wenn das erforderlich ist, damit öffentliche Stellen ihre Aufgaben erfüllen können. Oder zur Wahrnehmung des Hausrechts. Die schutzwürdigen Interessen der gefilmten Mitarbeiter dürfen nicht stärker wiegen als das Interesse des Arbeitgebers.
In manchen Bereichen dürfen Mitarbeiter grundsätzlich nicht gefilmt werden. Das gilt für Räumlichkeiten, die in erster Linie privat genutzt werden. Beispiele hierfür sind Umkleideräume, Pausenräume oder Toiletten. Auch in Sanitärräumen und Schlafräumen darf der Arbeitgeber keine Kameras anbringen. Er würde sonst in die Intimsphäre seiner Mitarbeiter eingreifen.
Sind Kamera-Attrappen am Arbeitsplatz zulässig?
Manchmal muss es aus Sicht von Arbeitgebern gar keine echte Kamera sein. Der Abschreckungseffekt ist oft wichtiger als eine tatsächliche Videoaufzeichnung. Dafür kann auch eine Kamera-Attrappe sorgen. Praktisch daran: Da keine Videoaufnahmen erfolgen, greifen die Bestimmungen von DSGVO und BDSG nicht. Es werden schließlich keine personenbezogenen Daten verarbeitet.
Rechtlich sind die Möglichkeiten für Arbeitgeber trotzdem beschränkt. Auch eine Fake-Kamera kann in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreifen. Es kann schon ausreichen, dass Arbeitnehmer davon ausgehen, dass sie bei der Arbeit gefilmt werden. Der Bundesgerichtshof sprach in einem Urteil vom März 2010 von einem „Überwachungsdruck“ – und stellte fest, dass Kamera-Attrappen deshalb verboten sein können (Az. VI ZR 176/09).
Beim Einsatz von Fake-Kameras gäbe es noch ein Hindernis: Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter umfassend über eine mögliche Videoüberwachung zu informieren. Wenn unechte Kameras eingesetzt werden, wäre ein ehrlicher Umgang damit nicht im Sinne des Arbeitgebers. Die nötige Transparenz würde es also nicht geben.
Mitarbeiter filmen: Diese Rechte haben Beschäftigte
In Deutschland sind Arbeitnehmer gegen willkürliche Videoaufnahmen im Job geschützt. Wenn der Arbeitgeber Videokameras einsetzt oder einsetzen möchte, ist es für die betroffenen Beschäftigten wichtig, ihre Rechte zu kennen.
Videoüberwachung im Job kann gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstoßen. Sie kann auch übermäßig in die Privatsphäre der Betroffenen eingreifen.
Arbeitnehmer haben ein Recht auf Informationen, wenn der Arbeitgeber sie filmen möchte. Der Arbeitgeber muss seine Mitarbeiter umfassend informieren, bevor er eine Kamera am Arbeitsplatz in Betrieb nimmt. Dazu gehören auch Angaben darüber, wie die Daten der gefilmten Personen geschützt werden.
Beschäftigte, die die Videoaufnahmen für unrechtmäßig halten, können rechtliche Schritte gegen ihren Arbeitgeber einleiten. Sie können den Arbeitgeber bei der zuständigen Datenschutzbehörde melden, wenn sie der Meinung sind, dass er gegen ihre Rechte verstößt. Beschäftigte dürfen darüber hinaus auf Unterlassung klagen, wenn die Überwachung nicht gesetzeskonform ist. Der Arbeitgeber muss die Überwachung dann sofort beenden. In schwerwiegenden Fällen können Betroffene zudem Schadensersatz vom Arbeitgeber verlangen.
Arbeitskräfte haben außerdem das Recht, zu verlangen, dass ihre Aufnahmen nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. Das gilt zumindest dann, wenn der Arbeitgeber kein berechtigtes Interesse daran hat, die Videoaufzeichnungen länger zu speichern. Wenn sie das möchten, dürfen Arbeitnehmer die Aufnahmen von sich ansehen.
Gefilmt bei der Arbeit: Wie kann man sich dagegen wehren?
Für viele Arbeitnehmer ist es belastend, im Job gefilmt zu werden. Sie fühlen sich übermäßig kontrolliert oder haben das Gefühl, dass der Arbeitgeber rechtswidrig handelt. Was können Betroffene tun, deren Arbeitgeber Videokameras in den Arbeitsräumen installiert hat?
Als erste Reaktion ist es sinnvoll, mit dem oder der Vorgesetzten zu sprechen. Der Chef kann erklären, warum und wie er seine Mitarbeiter filmt. Betroffene Mitarbeiter können Vorgesetzte außerdem darauf hinweisen, dass Videoaufzeichnungen möglicherweise nicht erlaubt sind. Im besten Fall informiert sich der Arbeitgeber dann noch einmal darüber, in welchem Rahmen Videoaufnahmen erlaubt sind, und sieht gegebenenfalls davon ab.
Auch der Betriebsrat ist ein Ansprechpartner. Er setzt sich für die Rechte von Arbeitskräften ein und kann den Arbeitgeber auf die Videoüberwachung ansprechen. Eine weitere interne Anlaufstelle ist der Datenschutzbeauftragte.
Es ist sinnvoll, möglichst detailliert zu dokumentieren, wie die Videoüberwachung erfolgt. Das ist wichtig, falls es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber kommt.
Ist der Arbeitgeber uneinsichtig, obwohl die Videoüberwachung (mutmaßlich) verboten ist, kann eine schriftliche Beschwerde der nächste Schritt sein. Betroffene können sich an eine Gewerkschaft wenden, die sie darin unterstützen kann, ihre Rechte durchzusetzen.
Gegen einen Arbeitgeber, der unrechtmäßig handelt, können Betroffene klagen. Wer über eine Klage nachdenkt, sollte sich unbedingt juristische Unterstützung durch einen Anwalt oder eine Anwältin holen. Ein Anwalt kann Betroffene beraten und beurteilen, ob der Arbeitgeber im Rahmen des Gesetzes handelt oder nicht. Kommt es zu einem Rechtsstreit mit dem Arbeitgeber, kann er oft wesentlich mehr erreichen als die Betroffenen alleine.
Videoüberwachung im Job: Tipps für Beschäftigte
Viele Arbeitnehmer sind verunsichert, wenn ihr Arbeitgeber Videokameras am Arbeitsplatz installiert. Oft ist vieles unklar: Welche Rechte haben Arbeitskräfte? Wie sollten sie sich verhalten? Kann man gegen die Videoüberwachung vorgehen? Die folgenden Tipps helfen Arbeitnehmern, angemessen auf das Filmen zu reagieren.
In erster Linie ist es wichtig, sich zu informieren. Darf der Arbeitgeber tun, was er tut (oder vorhat)? Um das beurteilen zu können, ist es wichtig, die Pläne des Arbeitgebers zu kennen. Darüber sollte der Vorgesetzte seine Mitarbeiter informieren. Tut er das nicht, sollten Beschäftigte ihrerseits nachfragen. Dabei ist es auch wichtig, sich mit den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens zu befassen.
Viele Arbeitgeber kennen die Datenschutzbestimmungen nicht oder nehmen es damit nicht so genau. Arbeitnehmer können und sollten auf ihre Rechte pochen. Dazu gehört es, dass sie den Arbeitgeber darauf ansprechen, wenn er sich (mutmaßlich) unrechtmäßig verhält. Zum Beispiel, weil er ihre Zustimmung zur Videoüberwachung nicht eingeholt hat.
Andere Arbeitsbereiche nutzen
Möglicherweise gibt es eine Betriebsvereinbarung, die Regelungen zur Videoüberwachung und zum Datenschutz enthält. Es lohnt sich, eine Betriebsvereinbarung durchzulesen, um mehr über die Kameraaufzeichnungen zu erfahren. Bei Fragen zum Thema ist nicht nur der Vorgesetzte ein guter Ansprechpartner, sondern auch der Betriebsrat.
Wenn im Büro oder Betrieb Kameras hängen, betrifft das meist nicht alle Arbeitsbereiche gleichermaßen. Wer sich mit der Videoüberwachung nicht wohlfühlt, kann sich gegebenenfalls vorrangig in Bereichen aufhalten, die nicht oder weniger stark überwacht werden. Ist eine Überwachung unumgänglich, sollten Beschäftigte darauf achten, sich im Job vorbildlich zu verhalten. Das Handy bleibt also besser in der Tasche.
Wer nicht sicher ist, ob der Arbeitgeber seine Mitarbeiter so filmen darf, wie er es tut, sollte sich nicht scheuen, sich an den Betriebsrat, den Datenschutzbeauftragten oder einen Rechtsanwalt zu wenden. Viele Arbeitgeber nehmen Gesetze erst dann ernst, wenn man sie in ihre Schranken weist und deutlich macht, dass man auf seine Rechte besteht.
Gibt es einen Trend zu mehr Überwachung im Job?
Vor nicht allzu langer Zeit war Videoüberwachung am Arbeitsplatz hierzulande eher die Ausnahme. Inzwischen setzen immer mehr Arbeitgeber auf Kameras, um ihre Mitarbeiter zu filmen – Tendenz steigend. Der Trend zu Videoüberwachung im Job betrifft manche Branchen stärker als andere. Das gilt etwa für den Einzelhandel, den Sicherheitssektor, die Logistik und Industrie, aber auch den öffentlichen Nahverkehr. Per Kamera werden Arbeitsabläufe überwacht, die Aufzeichnungen sollen Diebstahl verhindern und die Sicherheit erhöhen.
Dass immer mehr Arbeitgeber Kameras in Büros und Betrieben installieren, hat noch einen anderen Grund: Die Technik ist günstiger als früher und leicht zu bekommen. Einfache Kameras, mit denen Mitarbeiter überwacht werden können, gibt es schon für 30 Euro bei Amazon und Co. Die Überwachungssysteme sind nicht nur erschwinglicher als früher, sie sind auch oft für Laien problemlos zu installieren. Dadurch sinkt die Hemmschwelle, solche Technik einzusetzen.
Die zunehmende Videoüberwachung im Job steht im Kontrast zu den strengeren Vorschriften zum Datenschutz. Sowohl das Bundesdatenschutzgesetz als auch die DSGVO haben es Arbeitgebern schwerer gemacht, ihre Mitarbeiter zu filmen. Das Bewusstsein für die Bedeutung von Datenschutz im Job steigt. Arbeitgeber sind deshalb gefragt, sich über ihre Möglichkeiten zu informieren und transparent mit der Videoüberwachung umzugehen.
In vielen anderen Ländern ist Videoüberwachung am Arbeitsplatz übrigens verbreiteter als in Deutschland (und der EU). Das gilt zum Beispiel für die USA, Großbritannien, China und Japan, wo die Bestimmungen zum Datenschutz weniger streng sind.
Bildnachweis: Roman Zaiets / Shutterstock.com